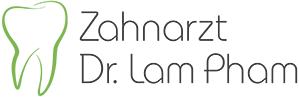Implantologie
Ein Zahnimplantat ist ein in den Kieferknochen eingesetztes „alloplastisches Konfektionsteil“. Das Teilgebiet der Zahnheilkunde, das sich mit der Insertion (Einsetzen) von Zahnimplantaten in den Kieferknochen befasst, wird als Implantologie bezeichnet. Durch ihre Verwendbarkeit als Träger von Zahnersatz übernehmen Zahnimplantate die Funktion künstlicher Zahnwurzeln. Hierzu werden sie entweder mittels Schraubgewinde in den Kieferknochen eingedreht oder eingesteckt. Sie verbinden sich innerhalb von 3 bis 6 Monaten mit dem umgebenden Knochen zu einer festen, äußerst belastungsfähigen Trägereinheit (Osseointegration).
Von der Implantatform hängt die chirurgische Insertionstechnik ab. Aus der Gestalt des Abutments, des aus dem Kieferknochen herausragenden Implantatteils, resultiert die Anfertigung der Suprakonstruktion, des auf den Implantaten einzugliedernden Zahnersatzes. Zahnimplantate bestehen seit den 1980er Jahren üblicherweise aus Titan, aber auch aus keramischen Materialien oder Kunststoff.
Wir bieten minimal invasive Methode der Implantation, wo das Zahnfleisch nicht mehr aufgeschnitten und aufgeklappt wird. Stattdessen wir eine kleine Öffnung gebohrt (Transgingival), durch die ein Implantat eingebracht werden kann.
Titanimplantate
Nach langen Jahrzehnten mit verschiedenen, heute zum Teil naiv anmutenden Implantatformen aus der Vorkriegszeit, haben sich rotationssymmetrische Implantate (meist Schraubenimplantate) durchgesetzt. Bei diesen Implantaten ist der Implantatkörper im Querschnitt kreisrund, so dass die Implantatkavität, der Hohlraum, der das Implantat aufnehmen soll, mit rotierenden Instrumenten, beispielsweise einem Kanonenbohrer, in den Kieferknochen präpariert werden kann. Die Schraubenimplantate unterscheiden sich vor allem in ihrer Konizität und in der Art des Gewindes.
Dieses chirurgische Vorgehen belastet den Patienten weniger als frühere Implantationstechniken und führt sehr selten zu Komplikationen bei der Wundheilung. Zudem haben Schraubenimplantate den Vorteil, dass sie sich durch ihr Gewinde sofort im Knochen „festsetzen“ (primäre Stabilität). Das verkürzt die Einheilzeit, weil nur wenig Knochen „nachwachsen“ muss. Bei einem Teil der Implantate verjüngt sich die zylindrische Grundformen apikalwärts, zum Ende hin, so dass insgesamt eine Konusform entsteht.
Im Gegensatz zur Orthopädie, in der vornehmlich Titanlegierungen eingesetzt werden, werden Zahnimplantate aus Reintitan hergestellt. Titan weist eine hohe Biokompatibilität auf, die keine allergischen oder Fremdkörperreaktionen auslöst. Titan geht im Gegensatz zu anderen Materialien eine direkte molekulare Verbindung mit dem Knochen ein. Hierbei spielt die raue, morphologische Oberflächengestaltung mit einer Mikro-Porentiefe von durchschnittlich 5 bis 100 µm eine Schlüsselrolle. Zu Beginn wurde dies durch Aufspritzen („additives Verfahren“) von Titanpulver unter Argon und Hochtemperatur erreicht. Dieses Verfahren ist verhältnismäßig teuer, so dass viele Hersteller etwa seit dem Jahr 2000 auf das billigere Säure-Ätz-Verfahren („acid etching“ oder Kombinationen davon, „SLA“ genannt) durch ein Gemisch von Salzsäure und Schwefelsäure zurückgreifen („subtraktive Verfahren“), das der additiven Methode gleichwertig oder sogar überlegen gegenübersteht.
Die Eigenschaft des Titans, mit Sauerstoff eine schützende Oxidschicht auf der Oberfläche zu bilden, ist die Ursache für seine besonders gute Verträglichkeit. Beide Methoden weisen eine hohe Erfolgsquote (über 95 % bei einer fünfjährigen Verweildauer) auf. Implantate müssen eine Zertifizierung der Gesundheitsbehörden als sichere Medizinprodukte (CE- oder eine FDA-Zulassung) besitzen. Ausnahmen bestehen gemäß Medizinproduktegesetz (MPG) für Individual-Implantate, die für einen einzigen Patienten auf Verschreibung des Zahnarztes angefertigt werden.
Überwiegend haben sich zusammengesetzte Zahnimplantate durchgesetzt, weil sie durch ihre Kombinationsmöglichkeit zwischen dem Wurzel- und Kronenanteil den gegebenen Verhältnissen am besten angepasst werden können, und weil durch das zweizeitige Vorgehen gewährleistet ist, dass die Osseointegration des Implantats durch eine zu frühe Belastung nicht beeinträchtigt wird. Mehrteilige Implantate bestehen aus dem im Knochen verankerten Implantatkörper, seltener einem separaten im Bereich der Mundschleimhaut liegenden Halsteil und dem Kopfteil, dem Abutment, das die Suprakonstruktion aufnimmt. Die zwei bzw. drei Teile werden meistens miteinander verschraubt. Die darauf angebrachten Suprakonstruktionen (Kronen, Brücken- oder Prothesenanker) werden verschraubt, zementiert oder verklebt.
Bei einteiligen Zahnimplantaten ragt der Implantatkopf aus der Schleimhaut heraus, womit eine vorzeitige Belastung während der Einheilphase oft nicht zu vermeiden ist.
Schmalkieferimplantate
Schmalkieferimplantate, auch als Mini-Implantate bekannt, haben einen Durchmesser von 1,8 bis 3,1 mm. Sie sind einzeln nur für kleine Zahnlücken geeignet und unterliegen Indikationseinschränkungen z. B. im Seitenzahngebiet. Aufgrund der schnelleren dimensionsbedingten Materialermüdung unter Kaubelastung sind sie meist einteilig konstruiert. Ein verbessertes bionisches Design sowie hochwertige Titangraduierungen oder Titanlegierungen führen zu einer erneut vermehrten Anwendung z. B. in der Altersprothetik. Nach diagnostischer Abklärung werden sie für minimalinvasive und einzeitige Operationsverfahren benutzt. Die bis heute nicht unumstrittene Technik wird prothetisch meist mit primärer Verblockung (Steg) oder sekundärer Verblockung mit verschiedenen Ankersystemen versorgt. Zielgruppe für derartige Verfahren sind Patienten, die nach ausführlicher Anamnese aus anatomischer, psychologischer oder finanzieller Sicht einer komplexeren konventionellen Implantatbehandlung nicht zugeführt werden können. Unbestritten ist der therapeutische Wert von Schmalkieferimplantaten z. B. beim temporären Einsatz in der Kieferorthopädie, zur intraoralen Fixierung von Bohrschablonen oder als Hilfsimplantate für umfängliche provisorische Implantatversorgungen.
Letztlich gibt es jedoch bei der inzwischen festzustellenden Erfolgsquote von durchweg über 95 % der gängigsten Implantattypen ohne künstliche Mineral- oder Proteinauflagerung kaum noch etwas zu verbessern. Die Ursachen der restlichen 3–4 % Verlust lassen sich wissenschaftlich nicht auf die Oberflächengestaltung oder die Form des Implantates zurückführen.